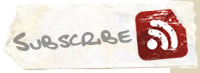Die zerbrechliche Zeit
Im Zentrum von Donatella Di Pietrantonios Roman „Die zerbrechliche Zeit“, übersetzt von Maja Pflug, entfaltet sich ein eindringliches Porträt einer Mutter-Tochter-Beziehung, die von einer fragilen Dynamik geprägt ist. Die Tochter, die ihr Studium abgebrochen hat, kehrt in das kleine Dorf in den Abruzzen zurück, ein Ort, der nicht nur ihre Kindheit, sondern auch die Schatten der Vergangenheit birgt. Hier, in dieser scheinbar idyllischen Umgebung, wird die Zerbrechlichkeit der menschlichen Beziehungen auf eine Weise sichtbar, die kaum erträglich ist.
Im ersten Drittel des Buches wird eine kaum auszuhaltende Spannung aufgebaut. Etwas ist geschehen, und die Leser*innen werden in einen Strudel aus Andeutungen und Erinnerungen hineingezogen. Die Erzählung entfaltet sich in kleinen, prägnanten Häppchen, die wie Puzzlestücke eine dunkle Geschichte zusammensetzen. Die Vergangenheit und die Gegenwart sind untrennbar miteinander verwoben, und die Dunkelheit, die den Ort umgibt, wird zu einem Charakter für sich. Die Figuren leben in einem ständigen Zustand der Ratlosigkeit, gefangen in einem Netz aus Schuld und Überlebensinstinkten.
Die Last der Vergangenheit
Alle im Dorf sind verbunden durch die unsichtbaren Fäden der Vergangenheit, die sie aneinander binden und gleichzeitig voneinander trennen. Die Schuldgefühle der zufällig verschonten, die Wut und Hoffnungslosigkeit der Überlebenden, die Ohnmacht der Angehörigen – all dies wird in eindringlichen Bildern und emotionalen Dialogen sichtbar. Die Leser*innen werden Zeugen, wie die Vergangenheit nach Jahrzehnten wieder ins Beben kommt. Entscheidungen müssen getroffen werden, und die Wunden, die so lange offen geblieben sind, verlangen nach Heilung, auch wenn Wunder nicht geschehen.
Der Titel „Die zerbrechliche Zeit“ könnte nicht passender gewählt sein. Alles in diesem Buch ist zerbrechlich: die Menschen, ihre Beziehungen, die Natur, die sie umgibt.